Julirevolution in Frankreich
-
Die Julirevolution in
Frankreich
Die
Julirevolution in Frankreich
sollte insbesondere beim deutschen Volk einen nachhaltigen Eindruck
hinterlassen. Die Wiederherstellung des
bourbonischen Königtums in Frankreich
erzeugte neue Gegensätze zwischen Bürgertum und Adel. Anstatt diese Gegensätze
zu überbrücken, war die neue Regierung unter König
Karl X. darum
bemüht, auch die letzten Auswirkungen der
Revolution von 1789 auszumerzen und
den Einfluss des Bürgertums noch weiter zurückzudrängen. Als der König
Karl X.
durch diktatorische Maßnahmen versuchte, das Wahlrecht zu ändern und die
Pressezensur einzuführen, kam es im Juli 1830 zum bewaffneten Aufstand in Paris.
Karl X. wurde vertrieben und anstatt seiner
Louis Philippe zum neuen König
ernannt. Der neue Herrscher wandte sich vom Gottesgnadentum ab und verstand sich
als „Bürgerkönig“, der sich nicht mehr auf den Adel stütze, sondern auf das
Bürgertum. Frankreich wurde mit seiner Regierungsform zum Vorbild aller
bürgerlichen Fortschrittsparteien in Europa.
-
Entwicklung in
Deutschland
Als eine der ersten deutschen
Reaktionen auf die französische
Julirevolution verjagten die Braunschweiger
ihren Herzog. Mit Sorge sahen andere deutsche Staaten diese Entwicklung und
gaben dem Volk die von ihnen gewünschten Verfassungen.
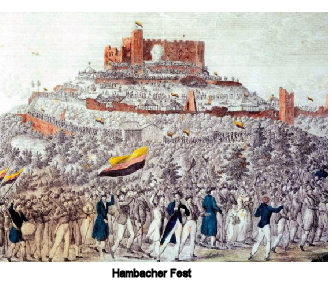 Im
Mai 1832 kam es zu einer bedeutenden Verkündigung für Einheit und Freiheit in
Hambach an der Weinstraße. Unter den „deutschen
Farben” Schwarz-Rot-Gold demonstrierten
mehr als 30.000 Menschen – unter ihnen der
Schriftsteller Ludwig Börne und zahlreiche Mitglieder der verbotenen
Burschenschaften – auf dem "Hambacher Fest". Sie forderten die Souveränität des Volkes, eine republikanische
Verfassung, die nationale Einheit Deutschlands „in einem konföderierten
Europa” und solidarisierten sich unter anderem mit der französischen
Julirevolution. Im „Hambacher
Lied“ wird der nationale Gedanke der Aufständigen deutlich.
Im
Mai 1832 kam es zu einer bedeutenden Verkündigung für Einheit und Freiheit in
Hambach an der Weinstraße. Unter den „deutschen
Farben” Schwarz-Rot-Gold demonstrierten
mehr als 30.000 Menschen – unter ihnen der
Schriftsteller Ludwig Börne und zahlreiche Mitglieder der verbotenen
Burschenschaften – auf dem "Hambacher Fest". Sie forderten die Souveränität des Volkes, eine republikanische
Verfassung, die nationale Einheit Deutschlands „in einem konföderierten
Europa” und solidarisierten sich unter anderem mit der französischen
Julirevolution. Im „Hambacher
Lied“ wird der nationale Gedanke der Aufständigen deutlich.
Auch
gegen den Frankfurter Bundestag kam es im April 1833 im „Frankfurter
Wachensturm“ zu einem Studentenputsch. Der politische Wille des deutschen Volkes
war unverkennbar.
Doch die Regierungen verstanden
und sahen das politische Aufbegehren ihrer Völker nicht. Anstatt einen Schritt
zum Volk zu machen, entschieden sich die Fürsten, die
Zensur noch strenger zu
handhaben und ordneten durch eine neu erschaffene Untersuchungskommission
Hunderte von Verhaftungen an. Allein schon das Zeigen einer schwarz-rot-goldenen
Fahne wurde geahndet. Bedeutsames Zeugnis der freien Meinungsäußerung war der
Protest der „Göttinger Sieben“, unter ihnen die
Gebrüder Grimm, die gegen die
Aufhebung der hannoverschen Verfassung protestierten. Es endete damit, dass alle
sieben Professoren aus dem akademischen Dienst entlassen wurden. Das deutsche
Volk zeigte Mitgefühl mit den Professoren und sammelte Geld, um ihnen ihr Gehalt
weiterhin zu bezahlen. Obwohl die Entlassung die gegenteilig erhoffte
Wirkung des hannoverschen Fürsten mit sich zog, ging die „Demagogenverfolgung“
weiter.
Der
Liberalismus
-
Aufstieg des Bürgertums
Durch die Einführung der
Maschine, den Aufschwung der Wirtschaft und die besseren Verkehrsverhältnisse,
begannen unter anderem auch die deutschen Städte aufzublühen. Eng verbunden war
hiermit der Aufstieg des Bürgertums. Durch den Wegfall der Zunftschranken und
die Einführung der Gewerbefreiheit hatte nun der Tüchtige die Möglichkeit, sich
durch eigene Arbeit zu Wohlstand zu verhelfen. Allmählich wurden die aus
früheren Zeiten stammenden Beschränkungen des Bürgertums (z. B.
Berufsbeschränkungen) zunehmend abgelehnt. Das Volk wollte sich nicht mehr
von der Obrigkeit bevormunden lassen.
-
Wesen und Ziele des
Liberalismus
Die Anhänger dieser
Betrachtungsweise nannten sich
Liberale. Diese verlangten die bürgerlichen
Grundfreiheiten, die sich aus den Menschenrechten erklärten sowie eine
konstitutionelle Regierung unter Teilnahme einer Volksvertretung. Wirtschaftlich
vertrat man das freie Unternehmertum, das Privateigentum und den Freihandel ohne
Zölle. Außenpolitisch forderten die
Liberalen Freiheit und Selbstbestimmung für
alle Völker und bemühten sich um den deutsch-nationalen Einheitsstaat.
Doch obwohl es in Deutschland
niemals zu einer Herrschaft des
liberalen Bürgertums
kam, waren die
liberalen Strömungen keineswegs
zu unterschätzen.
Die
Wirtschaft – Wegbereiterin der deutschen Einheit
-
Die Anfänge der
Industrialisierung in Deutschland
Die
industrielle Entfaltung
Deutschlands wurzelte indirekt in der
Kontinentalsperre
Napoleons. Als von England
weder Eisen noch Kohle nach Deutschland
geliefert werden konnten, entwickelte sich im Ruhrgebiet allmählich eine
Schwerindustrie. Auch die Tuch- und Leinenindustrie erhielt neuen Auftrieb. In
der Landwirtschaft wurde der überseeische Rohrzucker durch die deutsche
Zuckerrübe ersetzt. Der Verzicht der Dreifelderwirtschaft erhöhte entscheidend
die Ernteerträge. Die Entwicklung von großen Fabriken wurde jedoch aufgrund der
Kleinstaaterei und Mangel an Kapital maßgebend erschwert.
Das Ende der
Kontinentalsperre
1815 führte zu einem Rücklauf der deutschen vorindustriellen Bestrebungen.
Englische Fabrikwaren überschwemmten wieder den deutschen Markt. Die hohe
Schuldenlast aus den Napoleonischen Kriegen und der Besatzungszeit konnte nur
langsam wieder abgebaut werden. Um die Zeit von 1815 kamen zudem noch einige
Missernten dazu, die eine Vergrößerung der bürgerlichen Armut nur noch
vergrößerten. Erst in den 1830er Jahren konnten viele Schwierigkeiten auf
diesem Gebiet überwunden werden. Eine neue Generation von Unternehmern wuchs
heran, so zum Beispiel Alfred Krupp, der eine Eisenverarbeitungsfabrik in Essen
gründete, die später viele tausende Arbeiter beschäftigte.
-
Der Deutsche Zollverein
Im Laufe der Zeit wuchsen die
einzelnen deutschen Staaten immer weiter zusammen. Bereits seit der Erwerbung
des Rheinlands und Westfalens drängte Preußen immer mehr auf eine Beseitigung
der Durchgangszölle, die den Handel innerhalb Deutschlands erschwerten. Die hohe
Anzahl an Zollschranken, die hohen Verwaltungskosten und der wachsende Schmuggel
wurden immer hinderlicher. Der Gedanke eines gesamtdeutschen Zollvereins, der zu
einem wirtschaftlich geeinten Deutschland beitragen sollte, wurde wach. Im Jahre
1834 wurde daraufhin der „Deutsche Zollverein“ gegründet, dem alle deutschen
Staaten – mit Ausnahme Österreichs – angehörten. Er umfasste ein Gebiet von
420.000 km2 mit etwas 23,5 Millionen Einwohnern.
-
Die ersten deutschen
Eisenbahnen
Westfälische Industrielle
förderten den Bau einer Eisenbahn zwischen Köln und Minden, planten ebenso eine
Kanalverbindung zwischen Rhein und Weser, um der Hansestadt Bremen Vorteile in
Falle der Industrieerzeugnisse zu bringen. Bayrische Geldgeber ermöglichten den
Bau der ersten deutschen Eisenbahn 1835 von Nürnberg nach Fürth. In der Zeit
zwischen 1840 und 1850 verzwölffachte sich die Anzahl der Streckennetze.
Deutsches
Geistesleben
In der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts konnte sich das deutsche Volk im politischen Bereich nicht
sonderlich durchsetzen. Auf dem Gebiet des Geistigen konnte man sich jedoch bei
weitem mit allen Völkern der Erde messen. Die französische Schriftstellerin
Madame de Staël hatte Deutschland um 1800 gar als „Land der Dichter und Denker“
bezeichnet. Während Goethe mit „Faust II“ sein einzigartiges Lebenswerk
abschloss, führte Beethoven in seinen späten Werken die abendländische Musik zu
einer neuen Höhe. Ebenso in der Philosophie tat sich Deutschland hervor. Der
Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel
schuf sein maßgebendes System der
Philosophie, das auch noch heute von nicht geringer Bedeutung ist. Seine
Deutungen der Geschichte als Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, des
Staates als verwirklichte sittliche Idee, waren für Europa von entscheidender
Bedeutung.
Zeitgleich machte sich seit den
1830er Jahren eine Bewegung des „Jungen Deutschland“ einen Namen, die mit
scharfer Kritik die politischen und sozialen Verhältnisse monierte.
Heinrich
Heine, Ludwig Börne und
Ferdinand Freiligrath wurden rasch volkstümlich. Ebenso
bedeutend war Georg Büchner, der mit seinen Dramen „Dantons Tod“ und „Woyzeck“
erst nach seinem Tod volle Anerkennung erlangte. Zu bemerken ist, dass alle
diese Personen ins Ausland fliehen mussten. Das reaktionäre Deutschland des
Biedermeiers war für diese kritischen und freien Geister nicht gedacht.
Deutschland vor der Revolution
-
Friedrich Wilhelm IV.
(1840 – 1861)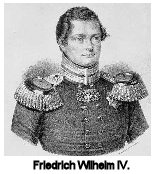
Im Jahre 1840 wurde
Friedrich
Wilhelm IV. zum König von Preußen ernannt. Mit dem Sohn
Friedrich Wilhelms III.
versprach man sich den Beginn einer freiheitlichen Ära, Einschränkung der
Polizeigewalt und Verstärkung der Volksrechte in einer modernen Verfassung. Doch
obwohl sich der neue preußische König als durchaus großzügig erwies und unter
anderem zahlreiche politische Verfolgte begnadigte (so zum Beispiel die Gebrüder
Grimm), änderte dieses nichts an dessen Einstellung. Denn gerade
Friedrich
Wilhelm IV. betonte sein Gottesgnadentum und stand damit im scharfen Gegensatz
zu den beiden geistlich-politischen Hauptströmungen der damaligen Zeit: der
Demokratie und dem
Liberalismus.
-
Soziale
Protestbewegungen
Der Wechsel von einer agrar- zu
einer kapitalistischen Industriegesellschaft mit dem gleichzeitig
explosionsartigen Zuwachs der Bevölkerung, sorgte für Probleme wirtschaftlicher
und sozialer Natur, denen die Regierungen lange Zeit nicht Herr werden konnten.
Auch die Erhöhung der Nahrungsmittelerzeugung, die bedeutenden technischen
Fortschritte sowie die Ausweitung der gewerblichen Produktion konnten den
Problemen nicht entgegenwirken. Die Wirtschaftskraft reichte in den meisten
Ländern einfach nicht aus, um Hunger, Not und Arbeitsmangel entgegenzuarbeiten.
Die Zeit der Frühindustrialisierung (1820 – 1850) wurde somit zu einem Zeitalter
der Massenarmut, des „Pauperismus“.
Schon in den Jahren 1816/17 führten Missernten zu Hungersnöten. In der Zeit
1846/47 verschärfte sich die Situation sogar noch, als eine Million Menschen den
Hungertod starben. Ebenso sorgte eine Cholera-Epidemie in den 1830er Jahren, der
insbesondere durch Unterernährung geschwächte Menschen zum Opfer fielen, für
eine wesentliche Verschlechterung der Lebenssituation der Bevölkerung.
Die zahlreichen Protestaktionen
dieser Zeit entstanden durchweg aufgrund solcher Notsituationen. Bauern
rebellierten unter anderem gegen die Nutzungsrechte am ehemaligen Gemeinbesitz,
die Handwerker forderten ein gerechtes Preis-Einkommens-Verhältnis und Arbeiter
protestierten gegen zu geringe Löhne und zu lange Arbeitszeiten.
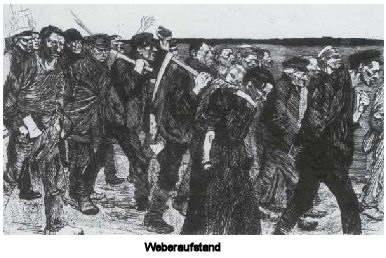 Die
Notlage der Weber in Ostwestfalen und Schlesien offenbarte sich 1844 im
schlesischen Weberaufstand. Als Handarbeiter waren die Leinenweber nicht in der
Lage, mit der Produktivität der modernen maschinellen Webstühle mitzuhalten. Sie mussten trotz längerer Arbeitsdauer immer niedrige Verkaufszahlen in Kauf
nehmen. Die Demonstrationen wurden vom preußischen Heer schnell
unterdrückt.
Die
Notlage der Weber in Ostwestfalen und Schlesien offenbarte sich 1844 im
schlesischen Weberaufstand. Als Handarbeiter waren die Leinenweber nicht in der
Lage, mit der Produktivität der modernen maschinellen Webstühle mitzuhalten. Sie mussten trotz längerer Arbeitsdauer immer niedrige Verkaufszahlen in Kauf
nehmen. Die Demonstrationen wurden vom preußischen Heer schnell
unterdrückt.
Doch nicht nur in Schlesien kam
es zu Unruhen, auch in anderen preußischen Provinzen war der Unmut der
Bevölkerung zu spüren. Der Ruf nach einem „Vereinigten Landtag“ wurde laut, der
die politische Mitbestimmung für alle preußischen Gebiete garantieren sollte.
Hatten bisher nur acht Provinzen die Möglichkeit, sich ins politische Leben des
Staates einzufügen, sollten mit dem „Vereinigten Landtag“ Vertreter ganz
Preußens zusammenkommen.
Friedrich Wilhelm IV. zeigte jedoch wenig Interesse,
diese Einrichtung als eine dauerhafte Institution Preußens zu etablieren. Immer
wieder betonte er sein Gottesgnadentum und wandte sich gegen eine freiheitliche
Verfassung.
Die
Revolution von 1848
-
Das Streben nach einer
demokratisch-freiheitlichen Verfassung
Während in Länder wie den
Vereinigten Staaten von Amerika oder den westeuropäischen Ländern das Bürgertum
an die Macht gelangt war, waren Preußen und Österreich in dieser Hinsicht immer
noch als rückständig zu bezeichnen. Noch immer herrschten dort absolutistische
Regierungsformen vor. Diese Verzögerung gegenüber dem Westen fand zum einen
seine Ursache in der Zersplitterung Deutschlands in viele kleinere Einzelstaaten
sowie in der Vernichtung des städtischen
Frühkapitalismus. Der Krieg gegen
Napoleon, die wirtschaftliche Vereinigung durch den
Deutschen Zollverein sowie
das Aufkommen des
Liberalismus schürten im Volk jedoch immer mehr den Wunsch
nach einer modernen demokratisch-freiheitlichen Verfassung.
-
Die deutsche
Märzrevolution von 1848
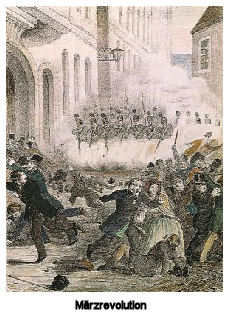 In
Deutschland fanden die Volksbewegungen der europäischen Nachbarländer großes
Ansehen. So erfolgten zum Beispiel im Januar 1848 die ersten italienischen
Bewegungen und auch in Frankreich brachen im Februar desselben Jahres
Barrikadenkämpfe aus. Diese Taten sorgten für Aufsehen im deutschen Volk, das
nun umso heftiger sein Recht auf Presse- und Redefreiheit und eine Einführung
der Volksbewaffnung verlangte. Ausgehend von Baden, der Rheinpfalz und
Westfalen, erfasste diese große Volksbewegung bald weite Teile Deutschlands.
Überall gaben die Regierungen kampflos auf und beugten sich dem Willen des
Volkes.
In
Deutschland fanden die Volksbewegungen der europäischen Nachbarländer großes
Ansehen. So erfolgten zum Beispiel im Januar 1848 die ersten italienischen
Bewegungen und auch in Frankreich brachen im Februar desselben Jahres
Barrikadenkämpfe aus. Diese Taten sorgten für Aufsehen im deutschen Volk, das
nun umso heftiger sein Recht auf Presse- und Redefreiheit und eine Einführung
der Volksbewaffnung verlangte. Ausgehend von Baden, der Rheinpfalz und
Westfalen, erfasste diese große Volksbewegung bald weite Teile Deutschlands.
Überall gaben die Regierungen kampflos auf und beugten sich dem Willen des
Volkes.
Ihren Höhepunkt fanden die
deutschen Märzevolutionen von 1848 in Berlin, wo sich eine große Menschenmenge
vor dem Berliner Schloss versammelte, um den Monarchen ihre Forderungen zu
übermitteln. Die gewaltbereite Menge zeigte sich erfreut, als der König den
Volkswünschen weitgehend entgegenkam. Während der Verhandlungen kam es jedoch zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Wachleuten,
zwei Schüsse fielen. Die Menge floh, aber nun wuchsen überall Barrikaden:
Pflaster wurden aufgerissen, Wagen umgeworfen. Das Volk griff zu den Waffen, es
folgten blutige Kämpfe in den Straßen Berlins.
Noch in derselben Nacht
entschloss sich der König, dem Treiben ein Ende zu setzen und willigte
vorbehaltlos in die Forderungen der kämpfenden Menge ein. Die Revolution hatte
gesiegt. Als Symbol der Anerkennung der Gefallenen zwang das Volk seinen
Monarchen durch Abnehmen seiner Mütze die Opfer der Barrikadenkämpfe zu ehren.
Dies stellte eine außergewöhnliche Tat in der Geschichte der preußischen
Monarchie dar. Der König musste sofort ein
liberales Kabinett einberufen und
verkündete von fortan, dass Preußen in einem fortschrittlichen und modernen
Deutschland aufgehen solle.
-
Die deutsche
Nationalversammlung
In der alten Reichsstadt
Frankfurt am Main trat die erste
deutsche Nationalversammlung in der
Paulskirche
zusammen, das erste gesamtdeutsche, frei gewählte und verfassungsgebende
Parlament. Dort versammelte sich eine geistige Auslese Deutschlands, die sich
vorwiegend aus Akademikern zusammensetzte. Personen wie
Jakob Grimm,
Ernst
Moritz Arndt, der
Turnvater Jahn,
Ludwig Uhland,
Brentano und
Fröbel
verschafften der Nationalversammlung auch über die Grenzen Deutschlands
Anerkennung. Zum Präsidenten wurde Heinrich von Gagern gewählt. 
Es dauerte jedoch nicht lange,
bis nach einiger Zeit die Vertreter des gebildeten Bürgertums von den
Forderungen der Radikalen abrückten. Zunehmend zeichnete sich eine
Parteienbildung ab, nachdem sich weite Kreise des Bürgertums den radikalen
Revolutionsforderungen entgegenstellten. Die wochenlangen Barrikadenschlachten
1830 in Paris waren für viele Abgeordnete jedoch ein warnendes Beispiel. So
wählten sie als Reichsverweser, d. h.
als Oberhaupt der provisorischen
Reichsregierung, den Erzherzog Johann. Da sich Preußen und Österreich gegen die
Forderung stellten, ihre Truppen auf den neuen
Reichsverweser zu vereidigen, war
die Nationalversammlung ohne eigenes Militär. Auch gewann sie keine
Verwaltungskompetenz gegenüber den Einzelstaaten. Ebenso die stetig
voranschreitende Aufspaltung der Abgeordneten in politische Zusammenschlüsse
führte dazu, dass man weitgehend machtlos blieb.
Die
Frankfurter
Nationalversammlung setzte im Dezember 1848 den ersten Grundrechtskatalog der
Deutschen auf. Nach langen Diskussionen schufen die Abgeordneten eine
Verfassung, die noch bis zum Bonner Grundgesetz von 1949 Einfluss haben sollte.
Dann geriet die Versammlung jedoch in Konflikt, als es zum Thema der nationalen
Einheitsbewegung kam. Ohne Zweifel bestand diese Bewegung bereits, jedoch
spaltete sie sich in eine
kleindeutsche
und großdeutsche
Lösung auf. Die
Kleindeutschen forderten die deutsche Reichseinheit unter der Herrschaft
Preußens und Ausschluss Österreichs, wohingegen die
Großdeutschen auch die
Deutschen der Donaumonarchie mit einbinden wollten.
Am 28. März 1849 wurde die
Reichsverfassung angenommen und
Friedrich Wilhelm IV. zum deutschen Kaiser
gewählt. Dieser sprach sich jedoch voller Verachtung gegen das feierliche
Angebot aus und lehnte die Kaiserkrone ab:
„Einen solchen imaginären Reif, aus Dreck und
Letten gebacken, soll ein legitimer König von Gottes Gnaden und nun gar der
König von Preußen sich geben lassen, der den Segen hat, wenn auch nicht die
älteste, doch die edelste Krone, die Niemand gestohlen worden ist, zu tragen?
... Ich sage es Ihnen rund heraus: Soll die tausendjährige Krone deutscher
Nation, die 42 Jahre geruht hat, wieder einmal vergeben werden, so bin ich es
und meines Gleichen, die sie vergeben werden. Und wehe dem, der sich anmaßt, was
ihm nicht zukommt!“
Damit war das Hauptanliegen der
Frankfurter Nationalversammlung, die Gründung eines deutschen Einheitsstaates,
gescheitert.
-
Der Sieg der Reaktion
Mittlerweile hatte sich der
Gegensatz zwischen dem auf der einen Seite gebildeten Bürgertum und den auf der
anderen Seite Arbeitern sowie von der aufkommenden Industrie bedrohten kleinern
Handwerkern immer weiter vertieft. Unter der Führung von Friedrich Hecker
versuchte das revolutionäre Volk, die Regierungsgewalt in Baden an sich zu
reißen. Die Widerstandsbewegung wurde aber von den Bundestruppen gewaltsam
niedergeschlagen. Ebenso wurden völkisch-revolutionäre Bewegungen in Ungarn sowie in Berlin und Dresden blutig vom staatlichen Militär
gestoppt. Obwohl in Österreich die revolutionären Mächte anfangs auch siegreich
waren und ihren Staatskanzler
Metternich als Symbol der
Reaktion stürzten, wurden
auch hier die bewaffneten Aufstände gewaltsam niedergeworfen. Die
Reaktion hatte
allerorts gesiegt.
Deutschland nach der Revolution
-
Auflösung der
Nationalversammlung
In Frankfurt am Main wurden die
Abgeordneten der Nationalversammlung durch Soldaten daran gehindert, der Sitzung
der Paulskirche beizuwohnen. In Berlin zog wieder der König mit seinen Soldaten
ein, die Bürgerwehr der Aufständischen wurde aufgelöst. Die Kämpfer für ein einheitlich-freies Deutschland wurden überall verfolgt und eingesperrt, manche
erschossen.
-
Die oktroyierte
Verfassung
Nach dem Sieg der
Reaktion wurde
auch bald in Berlin ein konservatives Ministerium ernannt und somit eine
Militärdiktatur errichtet. Die preußische Nationalversammlung musste auseinander
treten, schließlich wurde das Wahlrecht geändert. Der König erließ eine
oktroyierte (von oben erlassene) Verfassung, d. h. sie wurde ohne Einwirkung des
Volkes beschlossen. Diese Verfassung von 1850 – die in Preußen bis 1918 galt – führte erstmals das Dreiklassenwahlrecht ein. Somit wurde die
Stimmenzahl nach der Steuerleistung bewertet. Die vollziehende Staatsgewalt
blieb alleinig in den Händen des Königs.
Der Versuch, die Gründung eines
einheitlichen und freiheitlichen Deutschland zu erreichen, erfolgte erst 21
Jahre später mit der
Reichsgründung 1871.
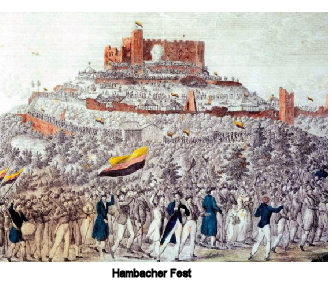 Im
Mai 1832 kam es zu einer bedeutenden Verkündigung für Einheit und Freiheit in
Hambach an der Weinstraße. Unter den „deutschen
Farben” Schwarz-Rot-Gold demonstrierten
mehr als 30.000 Menschen – unter ihnen der
Schriftsteller Ludwig Börne und zahlreiche Mitglieder der verbotenen
Burschenschaften – auf dem "Hambacher Fest". Sie forderten die Souveränität des Volkes, eine republikanische
Verfassung, die nationale Einheit Deutschlands „in einem konföderierten
Europa” und solidarisierten sich unter anderem mit der französischen
Julirevolution. Im „Hambacher
Lied“ wird der nationale Gedanke der Aufständigen deutlich.
Im
Mai 1832 kam es zu einer bedeutenden Verkündigung für Einheit und Freiheit in
Hambach an der Weinstraße. Unter den „deutschen
Farben” Schwarz-Rot-Gold demonstrierten
mehr als 30.000 Menschen – unter ihnen der
Schriftsteller Ludwig Börne und zahlreiche Mitglieder der verbotenen
Burschenschaften – auf dem "Hambacher Fest". Sie forderten die Souveränität des Volkes, eine republikanische
Verfassung, die nationale Einheit Deutschlands „in einem konföderierten
Europa” und solidarisierten sich unter anderem mit der französischen
Julirevolution. Im „Hambacher
Lied“ wird der nationale Gedanke der Aufständigen deutlich. 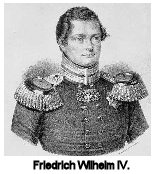
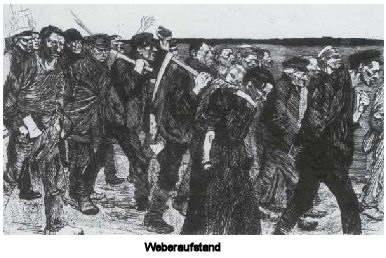 Die
Notlage der Weber in Ostwestfalen und Schlesien offenbarte sich 1844 im
schlesischen
Die
Notlage der Weber in Ostwestfalen und Schlesien offenbarte sich 1844 im
schlesischen 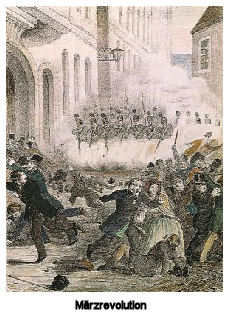 In
Deutschland fanden die Volksbewegungen der europäischen Nachbarländer großes
Ansehen. So erfolgten zum Beispiel im Januar 1848 die ersten italienischen
Bewegungen und auch in Frankreich brachen im Februar desselben Jahres
In
Deutschland fanden die Volksbewegungen der europäischen Nachbarländer großes
Ansehen. So erfolgten zum Beispiel im Januar 1848 die ersten italienischen
Bewegungen und auch in Frankreich brachen im Februar desselben Jahres
